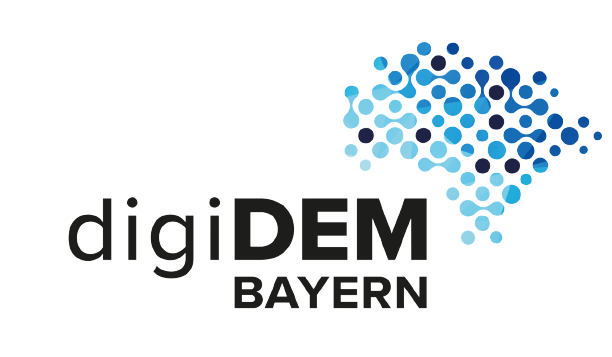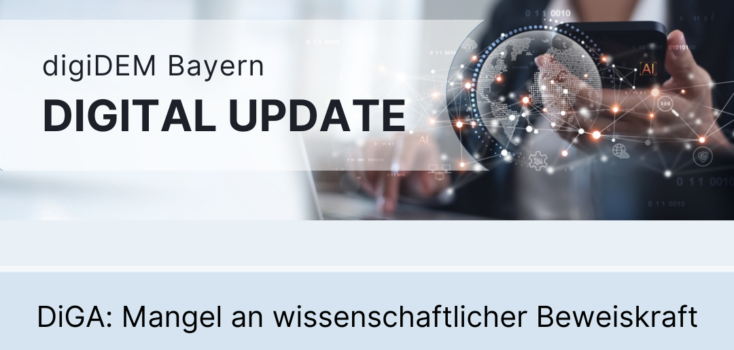Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) dienen dazu, Krankheiten zu erkennen, zu überwachen, zu behandeln oder deren Symptome zu lindern. Doch nur jene DiGA werden in Deutschland von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auch zugelassen wurden. Geprüft werden hierbei zunächst unter anderem Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Danach erfolgt die Beurteilung der sogenannten positiven Versorgungseffekte der „App auf Rezept“.
Das „Digitale Versorgung-Gesetz“ (DVG) definiert die Effekte auf zweierlei Weise. Entweder die App hat einen medizinischen Nutzen, indem sich zum Beispiel der Gesundheitszustand und die Lebensqualität verbessern oder sich die Krankheitsdauer verkürzt. Oder es liegen patientenrelevante Verbesserungen in Strukturen und Prozessen vor – wenn sich zum Beispiel Patientensicherheit und Gesundheitskompetenz erhöhen oder Patientinnen und Patienten dank App den Alltag besser bewältigen können. Für eine dauerhafte Zulassung muss der Hersteller innerhalb von zwölf Monaten nach vorläufiger Zulassung ausreichende Evidenz vorlegen.
Eine Studie aus Deutschland, die im August 2025 publiziert wurde, hat nun alle bis zum Untersuchungszeitpunkt veröffentlichten wissenschaftlichen Studien für die Zulassung der im DiGA-Verzeichnis dauerhaft aufgenommenen digitalen Gesundheitsanwendungen analysiert. Schließlich sollen die DiGA den Patientinnen und Patienten einen verlässlichen Nutzen bringen. In der Übersichtsarbeit wurden 23 Zulassungsstudien für 21 dauerhaft zugelassene DiGA ausgewertet. Die Studien wurden zwischen 2012 und 2022 durchgeführt und umfassten 56 bis 1.245 Teilnehmende. Die Interventionsdauer, also die Anwendungszeit der DiGA, lag zwischen eineinhalb und 12 Monaten.
Die meisten Studien (13 von 23) bezogen sich auf psychische Erkrankungen. Mit durchschnittlich 69 Prozent nahmen überwiegend Frauen an den Studien teil, das Durchschnittsalter betrug 42 Jahre. Jede der analysierten Studien wurde als sogenannte randomisierte kontrollierte Studien durchgeführt. Dieses Studiendesign gilt als wissenschaftlich anerkannter Goldstandard, um klinische Evidenz nachzuweisen.
Die gute Nachricht: Allen Studien berichteten mittlere bis große positive Effekte, die die DiGA hervorgerufen haben. Doch viele Zulassungsstudien weisen erhebliche methodische Schwächen auf – etwa fehlende Transparenz durch das Fehlen von Studienprotokollen vor der Studiendurchführung, eine fehlende „Verblindung“, viele Studienabbrüche, insbesondere in der Behandlungsgruppe, oder fehlende Langzeitdaten. Das heißt: Die wissenschaftliche Beweiskraft für die Wirksamkeit vieler DiGA ist derzeit gering.
„Im Sinne einer allgemeinwohlorientierten Gesundheitsversorgung sollten höhere Evidenzanforderungen an die Zulassungsstudien von DiGA gestellt werden, um zu vermeiden, dass DiGA mit überschätzter Wirksamkeit Einzug in die Versorgung erhalten.“
Dr. Nikolas Dietzel, digiDEM Bayern-Wissenschaftler
Ein Manko war also das in der Übersichtsarbeit als hoch bewertete sogenannte Verzerrungsrisiko (englisch: risk of bias). Dabei handelt es sich um systematische Fehler in der Planung oder Durchführung von Studien, die zu einer Überschätzung des Behandlungseffekts führen können. Für die Interpretation von Forschungsergebnissen ist ein hohes Verzerrungsrisiko von großer Bedeutung. Denn es kann zu nicht-repräsentativen, einseitigen oder auch irreführenden Ergebnissen führen und damit die Aussagekraft des Forschungsergebnisses erheblich einschränken.
So lagen beispielsweise die durchschnittlichen Abbruchraten in den Zulassungsstudien der DiGA bei 21,7 Prozent in der Behandlungsgruppe und bei 11,8 Prozent in der Kontrollgruppe. Mögliche Erklärungen für die Abbrüche in der Behandlungsgruppe könnten sein, dass die Apps die Erwartungen der Patientinnen und Patienten nicht erfüllt oder dass sie nicht zum Tagesablauf der Teilnehmenden passten.
Für die Zulassungsstudien der DiGA-Hersteller seien, so die Studienautorinnen und -autoren, verbesserte methodische Standards und Transparenz notwendig, um das Vertrauen in digitale Gesundheitsanwendungen zu stärken. Die Forschenden aus Deutschland fordern deshalb strengere Vorgaben für die Durchführung einer Studie über den Nachweis des positiven Versorgungseffekts, mehr Transparenz beim BfArM und verbindliche Qualitätsstandards für Studien.
In der Praxis werden DiGA oft mehrfach oder über einen längeren Zeitraum verschrieben, da sie meist chronische Krankheiten behandeln. Daher könnte es, so die Übersichtsarbeit, sinnvoll sein, eine obligatorische Analyse der langfristigen Auswirkungen von DiGA auf die Gesundheitsversorgung in den Zulassungsprozess aufzunehmen – was mit der sogenannten anwendungsbegleitenden Erfolgsmessung (abEM) auch geplant ist.
Tipp für die Praxis:
Besprechen Sie die Nutzung einer DiGA mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und lassen Sie sich insbesondere auch über Stärken, Schwächen und die Wirksamkeit der DiGA aufklären.
Hier gelangen Sie zur Studie:
Erfahren Sie mehr zum Thema Digitale Gesundheitsanwendungen:
Unsere Kollegen Dr. Nikolas Dietzel, Dr. Michael Zeiler und digiDEM Bayern-Projektleiter Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas haben in einer Übersichtsarbeit, die im Januar 2025 publiziert wurde, die wissenschaftliche Qualität der Zulassungsstudien für DiGA sowie deren Preisgestaltung analysiert. Das Fazit: Viele der durchgeführten Studien zum Nachweis der Wirksamkeit weisen erhebliche wissenschaftliche Mängel auf. Unseren Artikel „App auf Rezept: Hohe Preise trotz mangelhaft nachgewiesener Wirksamkeit“ finden Sie hier.
digiDEM Bayern entwickelt digitale Angebote für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Demenz sowie für pflegende An- und Zugehörige und ehrenamtliche Helfende und stellt die Angebote auf digiDEM-Bayern.de zur Verfügung.
Hätten Sie es gewusst? Mit mehr als 3.000 Teilnehmenden hat das größte Demenzregister Deutschlands einen neuen Höchststand erreicht. Das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP) geförderte Leuchtturmprojekt zählt damit zugleich zu den größten europäischen Vorhaben zur Erfassung von Langzeitdaten im Bereich der Versorgungsforschung zu Demenzen. „Das Demenzregister ist ein Wissensspeicher von unschätzbarem Wert“, sagt digiDEM Bayern-Projektleiter Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. Für Entscheider aus der Gesundheitspolitik sind die validierten Erkenntnisse aus den ausgewerteten Daten von großem Interesse. Denn die Ergebnisse tragen dazu bei, zielgerichtete Maßnahmen für Betroffene zu entwickeln besonders in ländlichen Regionen. Oft mangelt es dort an Unterstützungsangeboten. Hier erfahren Sie mehr darüber.
Alle Newsletter, die bisher erschienen sind, können Sie auch Nachlesen: Hier geht’s zu unserem Newsletter-Archiv.
Nutzen Sie auch unseren digitalen Fragebogen „digiDEM Bayern DEMAND®“ und empfehlen Sie ihn weiter. Er hilft pflegenden An- und Zugehörigen, die eigenen Versorgungsbedarfe zu erkennen, wenn der Pflegebedarf von Menschen mit Demenz steigt. Hier gelangen Sie zum Fragebogen „digiDEM Bayern DEMAND®“.
Hier geht’s zu den bisherigen Ausgaben unseres Newsletters digiDEM Bayern DIGITAL UPDATE.