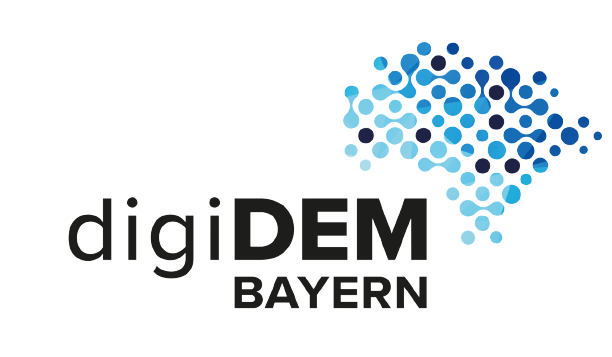Die Diagnosestellung von Demenz erfolgt häufig mit deutlicher zeitlicher Verzögerung. Zwei Studien aus Deutschland begründen wissenschaftlich, warum es wichtig ist, dass Demenzdiagnosen zeitgerecht gestellt werden.
Gerechnet ab dem Zeitpunkt der ersten Symptome dauert es bis zu zwei Jahre, bis die Demenzdiagnose gestellt wird. Zu diesem Ergebnis kam ein Team von Wissenschaftler*innen um Franziska Wolff von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie forschte im Rahmen des von der Bayerischen Staatsregierung geförderten Projektes BayDem über „Zeitgerechte Diagnosestellung bei Menschen mit Demenz“. Die Forschenden schreiben: „Die Sicherstellung einer zeitgerechten Diagnose stellt die Grundlage für die Inanspruchnahme von Therapie- und Unterstützungsleistungen für Menschen mit Demenz (MmD) sowie für deren pflegende Angehörige dar.“

Über die eigenen kognitiven Defizite berichten Betroffene oft nicht, wenn sie eine Demenz entwickeln. Sei es, weil die Fassade noch aufrechterhalten werden soll oder weil bei demenziellen Erkrankungen schon frühzeitig die Krankheitseinsicht beeinträchtigt ist. Dies erschwert die ärztliche Diagnoseroutine, geistige Abbauprozesse können leicht übersehen werden, es kann teilweise zu Fehldiagnosen kommen.
So viel Unabhängigkeit wie möglich erhalten
„Ein Ziel der „zeitgerechten Diagnose“ einer beginnenden kognitiven Beeinträchtigung ist es, dem Patienten so viel Unabhängigkeit so lange wie möglich zu erhalten“, heißt es in einer Übersichtsarbeit, die 2021 in den USA erschienen ist.
Laut der US-Studie ermöglicht eine zeitgerechte Untersuchung der kognitiven Beeinträchtigungen die Therapie behandelbarer Ursachen wie zum Beispiel Angstzustände, Vitaminmangel, Schlafstörungen und Hör- oder Sehverlust. Wird die Demenzdiagnose zeitgerecht gestellt, bleibt mehr Zeit für die Aufklärung und Beratung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen hinsichtlich der Auswirkungen der Erkrankung. Dies kann, so schreiben die Autor*innen, dazu beitragen, mögliche Folgeerscheinungen wie etwa Unfallrisiken und familiäre Unstimmigkeiten und die Belastung der pflegenden Angehörigen zu mildern.
Zudem lassen sich die Möglichkeiten zur Kontrolle von Begleiterkrankungen erweitern. Das bedeutet: Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, die häufig mit einer Demenz einhergehen und die zum kognitiven Verfall beitragen können, werden mitbehandelt. Ändert sich der Lebensstil, indem Menschen mit Demenz etwa ihren Lebensstil ändern und sich zum Beispiel mehr bewegen und die Ernährung umstellen, kann sich der kognitive Abbau verlangsamen. Des Weiteren lassen sich pharmakologische und nicht-pharmakologische Therapien in die Wege leiten.