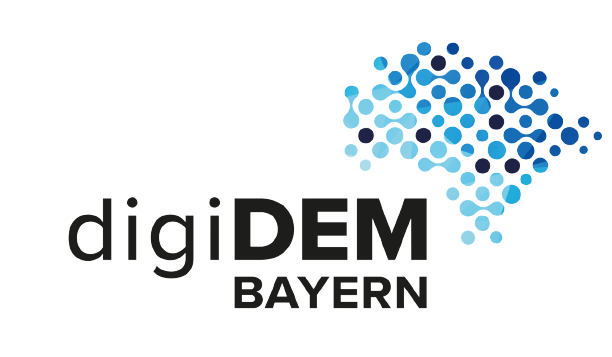Hausärztliche Versorgung, hauswirtschaftliche Hilfen oder die Inanspruchnahme einer Tagespflege: Lässt das Gedächtnis nach oder fällt zuhause die Orientierung immer schwerer, steigt der Bedarf an Unterstützung, um die Aufgaben des täglichen Lebens wie etwa Einkaufen oder Körperpflege zu meistern. Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen nutzen dabei ambulante Unterstützungsangebote seltener als Menschen, die von einer leichten bis mittelschweren Demenz betroffen sind – die Unterschiede sind jedoch gering. Zu diesem Ergebnis gelangten Forschende des Digitalen Demenzregisters Bayern (digiDEM Bayern) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Gegenüber Menschen mit einer leichten bis mittelschweren Demenz ist bei Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen (Mild Cognitive Impairment, MCI) der kognitive Abbau weniger ausgeprägt. Alltägliche Tätigkeiten – wie etwa einkaufen, sich der Körperpflege widmen oder Bankgeschäfte zu erledigen – können Menschen mit MCI aufgrund der nur leichten kognitiven Einschränkungen weitgehend selbstständig bewältigen.

Allerdings entwickelt sich bei etwa 70 Prozent der Menschen mit MCI innerhalb von fünf Jahren eine Alzheimer-Demenz – was einen erhöhten Bedarf an Unterstützung nach sich zieht. Da die meisten Menschen mit MCI oder Demenz zu Hause von ihren An- und Zugehörigen versorgt werden, bedeutet dies für die Pflegenden eine stetig steigende Belastung.
Erste Anzeichen von kognitiven Beeinträchtigungen nicht ignorieren
Daher ist es wichtig, die Versorgungssituation bei Menschen mit MCI langfristig zu berücksichtigen. Manche Unterstützungsangebote richten sich auch direkt an pflegende An-und Zugehörige, wie zum Beispiel Beratungsangebote oder die sogenannte Verhinderungspflege. „Oft suchen sich Betroffene erst dann Unterstützung, wenn die Belastung durch die häusliche Pflegesituation bereits stark
ausgeprägt ist“, sagt Anne Keefer, Erstautorin der Studie und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei digiDEM Bayern. Deshalb sollten Betroffene bereits bei ersten kognitiven Beeinträchtigungen möglichst rechtzeitig über die verschiedenen Möglichkeiten ambulanter Unterstützungsangebote informiert werden.
Fehlende Verfügbarkeit und Angst vor Stigmatisierung
Die bisherige Forschung befasste sich hauptsächlich damit, inwiefern Menschen mit Demenz und deren An- und Zugehörige ambulante Unterstützungsangebote in Anspruch genommen haben. „Wir wissen aber wenig darüber, welche Angebote Menschen mit MCI und ihre Angehörigen tatsächlich nutzen“, weiß Anne Keefer. In der Studie fanden Anne Keefer und ihre Kollegen heraus: Sowohl Menschen mit MCI als auch Menschen mit Demenz nutzen am häufigsten die Unterstützungsangebote „Hausärztliche Versorgung“ (54,4 Prozent), „Hauswirtschaftliche Hilfen“ (36,5 Prozent) „Ambulante Pflege“ (30,4 Prozent) und „Psychosoziale Interventionen“ (30,2 Prozent).
Insgesamt ist die Inanspruchnahme von ambulanten Unterstützungsangeboten eher gering.“ Die Gründe dafür können vielfältig sein. „Die Betroffenen könnten bislang kaum Unterstützungsbedarf haben“, sagt Anne Keefer. „Aber auch die fehlende Verfügbarkeit von Unterstützungsangeboten, ein mangelndes Wissen, dass es solche Angebote überhaupt gibt, Angst vor Stigmatisierung, Fragen der Finanzierung oder persönliche Werte und Überzeugungen können dazu führen, dass trotz eines vorhandenen Bedarfs Unterstützung nicht in Anspruch genommen wird.“
Unterschiede bei der Inanspruchnahme
Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass Menschen mit MCI vier von dreizehn betrachteten Unterstützungsleistungen seltener in Anspruch nehmen als Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz. So nutzen Menschen mit MCI seltener die Unterstützungsangebote „ambulante Pflegedienste“, „Tagespflege“ und „Verhinderungspflege“ und erwerben seltener „Hilfsmittel“ wie etwa Geh-, Hör- oder Sehhilfen. Alle anderen untersuchten ambulanten Unterstützungsangebote werden von Menschen mit MCI und leichter bis mittelschwerer Demenz zu gleichen Anteilen genutzt, dazu gehören unter anderem „Ambulante Pflegedienste“, „Hauswirtschaftliche Hilfen“ oder auch „Alternative Wohnformen“.
Überraschendes Ergebnis
In einer weiteren Analyse haben die FAU-Forschenden nicht mehr nur die einzelnen Unterstützungsangebote, sondern die Gesamtanzahl der genutzten Angebote betrachtet. Zusätzlich wurden neben der Gruppenunterscheidung “MCI vs. Demenz” auch andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildungsgrad,
Schwerbehinderung oder auch das Vorhandensein eines Pflegegrads berücksichtigt. So wurden im Durchschnitt etwa zwei ambulante Unterstützungsangebote innerhalb der letzten 30 Tage genutzt, wobei auch hier Menschen mit MCI insgesamt durchschnittlich weniger Angebote als Menschen mit leichter bis moderater Demenz genutzt haben. „Dieses Ergebnis hat uns überrascht, denn man würde erwarten, dass Menschen mit MCI einen deutlich geringeren Unterstützungsbedarf als Menschen mit einer leichten bis mittelschweren Demenz haben“, erläutert Prof. Dr. Elmar Gräßel, Co-Autor und Projektleiter von digiDEM Bayern. Um diese unerwarteten Studienergebnisse zu erklären, haben die Forschenden weitere mögliche Einflussfaktoren untersucht.
Pflegegrad als wesentlicher Faktor
„Vor allem das Vorhandensein eines Pflegegrads steht in besonders starkem Zusammenhang mit der Nutzung von ambulanten Unterstützungsangeboten“, weiß die Gerontologin Anne Keefer. Ein Grund dafür könnte das umfassende Beratungsangebot sein, dass der Medizinische Dienst Bayern im Rahmen seiner Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und von Leistungsansprüchen bei gesetzlich Versicherten vorhält. „Wer einen Pflegegrad erhalten hat, kann je nach Pflegegrad mit finanzieller Hilfe für Unterstützungsleistungenrechnen“, sagt Co-Autor und digiDEM Bayern-Projektleiter Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas.
Die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten hängt aber nicht nur mit den kognitiven Fähigkeiten in Zusammenhang. Zu den weiteren Faktoren, die dazu beitragen, gehören ein höheres Alter, weiblichen Geschlechts zu sein, allein zu leben und eine subjektiv als gering empfundene Lebensqualität.
Frühzeitige Unterstützung ist wichtig
Bei ersten Symptomen kognitiver Einschränkungen sollte, so die Forschenden, der Fokus insbesondere auf Angeboten zur Beratung und Unterstützung liegen. Angebote zur Pflege und Betreuung werden erst mit dem Fortschreiten der Erkrankung immer wichtiger. „Wir empfehlen, sich rechtzeitig über ambulante Unterstützungsangebote zu informieren und die Zugangswege zu Unterstützungsangeboten zu erleichtern, um die Versorgung von Menschen mit MCI und Demenz zu verbessern und die Belastung pflegender An- und Zugehöriger möglichst gering zu halten“, sagt Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas.
Die digiDEM Bayern-Studie umfasste die Teilnahme von 913 Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen, deren Daten im Demenzforschungsprojekt digiDEM Bayern erhoben wurden. Von diesen hatten 389 MCI und 524 eine leichte bis moderate Demenz. Insgesamt wurden dreizehn Unterstützungsangebote des Fragebogens „The Dementia Assessment of Service Needs (DEMAND)“ betrachtet. Der Online-Fragebogen digiDEM Bayern DEMAND® hilft pflegenden An- und Zugehörigen, die eigenen Versorgungsbedarfe zu erkennen und wurde hauptverantwortlich von Dr. Nikolas Dietzel, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei digiDEM Bayern, entwickelt.
Originalstudie:
Zum Online-Fragebogen digiDEM Bayern DEMAND® gelangen Sie hier.