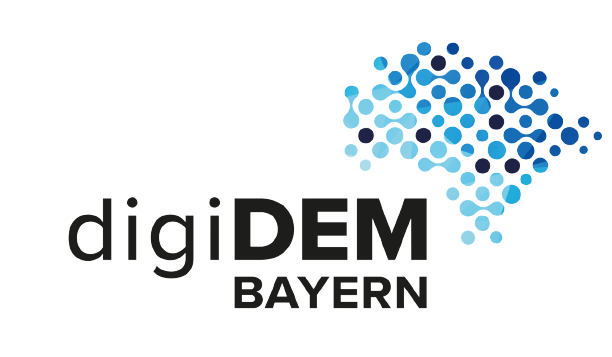Bundesverdienstkreuz am Bande für Prof. Dr. med. Elmar Gräßel
Pionier der Demenzversorgung und Angehörigenforschung: Für seine herausragenden Leistungen in der Demenzforschung und im Ehrenamt wurde Prof. Dr. med. Elmar Gräßel heute mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Die Auszeichnung überreichte der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder an Prof. Dr. med. Elmar Gräßel bei einer …