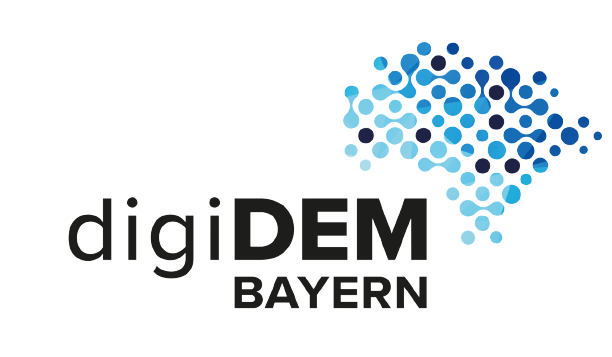Um Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (Mild Cognitive Impairment, kurz MCI) zu versorgen, bedarf es wissenschaftlich belegter Empfehlungen für die MCI-Diagnostik und Behandlung. Forschende aus China haben einen systematischen Überblick über 13 Leitlinien – darunter vier Praxisleitfäden und neun sogenannten Konsenserklärungen von Fachexperten – zusammengestellt und miteinander verglichen.
Die Forschenden ziehen das Fazit: Potenziell wirksame Diagnosen und Behandlungen, sowohl konventionelle als auch komplementäre und alternative Therapien, sollten in Zusammenhang mit den unterstützenden wissenschaftlichen Nachweisen hoch bewertet und berücksichtigt werden.“
Leichte kognitive Beeinträchtigungen gelten als einÜbergangsstadium zwischen dem normalen kognitiven Abbau im Alter und einer Demenz. Daher sei das Management der Erkrankung entscheidend und erfordere „erhebliche Aufmerksamkeit“, schreiben die Forschenden. In ihrer Übersicht wurden 13 Leitlinien, darunter vier Praxisleitfäden und neun sogenannte Konsenserklärungen von Fachexperten, betrachtet.
Leitlinien für Screening und Diagnose

Allein neun der Leitlinien und Konsenserklärungen befassten sich mit dem Screening und der Diagnose von MCI. Als häufigste Empfehlungen für die MCI-Diagnose wurden neuropsychologische Tests sowie Biomarker-Analysen, also zum Beispiel Magnetresonanztomographie (MRT) und die sogenannte Amyloid-Positronen-Emissions-Tomographie (Amyloid-PET) genannt. Drei Leitfäden weisen dabei darauf hin, dass Kliniker die klinische Anamnese mit neuropsychologischen Tests im diagnostischen Prozess kombinieren sollten.
Im Rahmen der MCI-Diagnostik werden zudem kognitive Tests wie zum Beispiel der Mini Mental Status Test (MMST) und das Montreal Cognitive Assessment (MoCA) empfohlen – diese gelten als die Screening-Instrumente, die am häufigsten verwendet werden und gleich mehrere kognitive Bereiche testen. Nahegelegt werden unter anderem auch Tests der Aktivitäten des täglichen Lebens.
Wie MCI behandelt werden kann
Um die Behandlung und das Management von MCI ging es in ebenfalls neun Dokumenten. Entsprechende Maßnahmen wurden in vier Kategorien eingeteilt: Interventionen zur Risikoreduktion, pharmakologische Interventionen, nicht-pharmakologische Interventionen und Beratung. Pharmakologische Interventionen empfehlen drei Leitlinien nicht.
Nicht-pharmakologische Behandlungsmaßnahmen werden hingegen in sieben Leitlinien empfohlen. Dazu gehören körperliche Aktivität, kognitive Interventionen, diätetische und ernährungsbezogene Interventionen wie zum Beispiel die mediterrane Diät sowie Akupunktur.
Die Forschenden geben an, dass alle 13 analysierten Leitlinien und Expertenkonsense nicht für die Beschäftigung mit MCI in der Allgemeinarztpraxis, Ausbildung, Schulung, Zertifizierung und Forschung vorgesehen sind.
Tipp für die Praxis: Risikoprävention ist essenziell, um die Wahrscheinlichkeit, an MCI zu erkranken, zu verringern oder den Erkrankungszeitpunkt hinauszuzögern. Im Falle einer Erkrankung empfehlen die Leitlinien zur Behandlung in erster Linie psychosoziale Interventionen wie körperliche oder kognitive Aktivität.
Hier geht’s zur Studie: