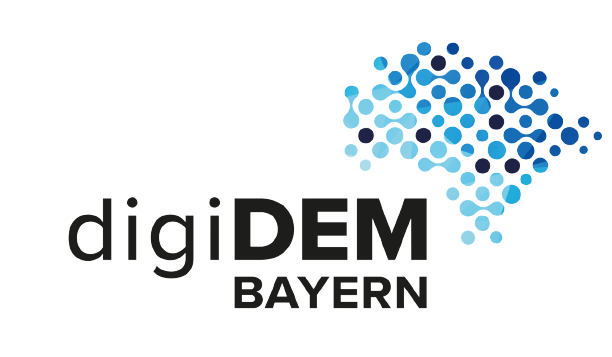Welche Lösungen gibt es für pflegebedürftige ältere Menschen, deren erwachsene Einzelkinder sie zwar gerne pflegen würden, aber weit entfernt oder gar im Ausland leben? Sie wollen Verantwortung übernehmen, können aber oft keine direkte Pflege leisten. Smart-Home-Technologien und Assistenzroboter scheinen auf den ersten Blick eine Lösung zu bieten: Sie versprechen Sicherheit, Gesundheitsüberwachung und sogar Gesellschaft für die Eltern, ohne dass die Kinder physisch anwesend sein müssen. Doch damit verbinden sich tiefgehende ethische Fragen.
In ihrer Studie, die im Juli 2025 im Fachmagazin BMC veröffentlicht wurde, untersuchten Forschende aus der Schweiz, Singapur und Deutschland zwei zentrale Fragestellungen. Sie wollten wissen, welche ethischen Fragen befragten Einzelkindern aufgeworfen haben, wenn sie speziell für die Pflege auf Distanz unterstützende, überwachende und robotergestützte Technologien in Betracht ziehen. Andererseits interessierten sich die Forschenden dafür, wie die Kinder ethische Bedenken mit den Möglichkeiten in Einklang bringen, die diese Technologien bieten könnten, um Herausforderungen in der Fernpflege zu mildern.
Im Mittelpunkt der Untersuchung standen 26 Erwachsene zwischen 28 und 45 Jahren, die räumlich getrennt und über mehrere Kontinente hinweg von Ihren zu pflegenden Eltern lebten. In Interviews gaben die Kinder Auskunft darüber, wie sie Chancen und Risiken von Fernüberwachung und tragbaren Technologien, sogenannten Wearables, die zum Beispiel Herzfrequenz, Aktivitätsniveau und Blutsauerstoffgehalt messensowie den Einsatz von Robotern für die Pflege ihrer Eltern abwägen. Darüber hinaus äußerten sie sich über die potenziellen Vor- und Nachteile von Robotern, die in der Pflege ihrer Eltern zum Einsatz kommen.
Für die Befragten waren zwei Spannungsfelder wichtig. „Erstens sahen die Teilnehmenden die Notwendigkeit, gute Ergebnisse bei der Pflege ihrer Eltern zu erzielen und ihre Verantwortung, deren Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, abzuwägen gegen den Respekt vor deren Autonomie, Würde und Privatsphäre“, heißt es in der Studie. Smart-Home-Systeme schaffen zwar Sicherheit, greifen aber in die Privatsphäre ein. Einige Teilnehmende hielten Eingriffe in die Autonomie für vertretbar, wenn sie die Gesundheit ihrer Eltern schützen. Andere legten mehr Wert auf Freiwilligkeit und Mitbestimmung.
Zweitens war für die Befragten das Verhältnis zwischen technologischer Unterstützung und echter emotionaler Nähe von großer Bedeutung. Ein Großteil der Kinder verstand Technik als Ergänzung, aber nicht als Ersatz für die persönliche Beziehung. Die Pflege durch ein Kind habe einen besonderen emotionalen Wert, den keine Maschine leisten könne.
„Viele Pflegesituationen erfordern eine individuelle Balance zwischen dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln und der menschlichen Zuwendung.“
Lisa Laininger, digiDEM Bayern-Wissenschaftlerin
Gleichzeitig betonten die Studienteilnehmenden den praktischen Nutzen technischer Hilfen. So können Sensoren Stürze melden oder etwa auf Anzeichen von Gedächtnisverlust hinweisen. Roboter hingegen können an die Einnahme von Medikamenten erinnern oder gegen Einsamkeit und soziale Isolation helfen. „Der Einsatz neuer Technologien könnte Kindern potenziell neue Möglichkeiten eröffnen, zur Pflege ihrer Eltern beizutragen, obwohl sie in räumlicher Distanz zu diesen leben“, schrieben die Forschenden. Wichtig war den Befragten jedoch, dass solche Geräte anpassbar bleiben – also etwa von den älteren Personen selbst kontrolliert werden können. So ließe sich Autonomie mit Sicherheit vereinen.
Die Studie legt dar, dass Entscheidungen für oder gegen den Einsatz von Technik nie rein pragmatisch getroffen werden, sondern auf komplexen Abwägungen beruhen: Schutz und Wohlbefinden der Eltern auf der einen Seite, Würde, Privatsphäre und familiäre Nähe auf der anderen Seite. Die Steigerung des Gesundheits- und Sicherheitsniveaus von zu pflegenden Eltern könne mit dem Verlust von Respekt vor Autonomie, Privatsphäre und Würde einhergehen. Viele Befragten betonten, ihre moralische Pflicht liege darin, Pflege verantwortungsvoll zu gestalten, auch wenn sie räumlich getrennt seien. Dennoch empfanden sie emotionale Bindung und menschliche Fürsorge als unersetzlich und wollten verhindern, dass Technologie ihre persönliche Beziehung ersetzt.
„Unsere Studie hat gezeigt, dass Fernpflegepersonen motiviert sind, Technologien zu nutzen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und die Gesundheit und Sicherheit ihrer Eltern zu gewährleisten. Allerdings beinhaltet die Entscheidung über den Einsatz dieser Technologien das Abwägen konkurrierender ethischer Überlegungen,“ so die Forschenden. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Smart-Home-Technologien Pflegehandlungen aus der Ferne zwar erleichtern, etwa das „Sich Kümmern“ und „Sich Sorgen“, aber die direkte körperliche Pflege kaum ersetzen können. Insgesamt verdeutlicht die wissenschaftliche Publikation: Fernpflege mit digitalen Mitteln ist mehr als eine technische Herausforderung – sie berührt fundamentale Fragen menschlicher Beziehungen, Verantwortlichkeit und Würde im Alter.
In ihrer Studie wiesen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf hin, dass ihre Forschungsergebnisse aufgrund der Auswahl der Studienteilnehmenden nicht verallgemeinerbar sind. So basierte die Studie hauptsächlich auf den Aussagen gut ausgebildeter chinesisch-stämmiger Einzelkinder, die über eine gewisse Offenheit für die Diskussion von Smart-Home-Technologien in der Altenpflege verfügten. Beachtet werden müsse auch, dass nur die Perspektiven der Kinder untersucht wurden, nicht aber die der Eltern, die am stärksten von der Nutzung der Technologien in der Pflege betroffen sein könnten.ist.
Tipp für die Praxis:
Sollten Sie räumlich weit entfernt von zu Ihren zu pflegenden Angehörigen leben, können Fernüberwachungs- und tragbare Technologien helfen, die Pflege auch aus der Ferne zu erleichtern. Technik sollte aber immer in Hinblick auf Autonomie und Selbstbestimmung der zu pflegenden Personen eingesetzt werden.
Hier gelangen Sie zur Studie:
Wussten Sie, dass häusliche Pflege auch Ihre positiven Seiten hat? Müdigkeit, Stress, wenig Freizeit oder das Gefühl mangelnder Anerkennung: Angehörige, die zum Beispiel Menschen mit Demenz in ihrem häuslichen Umfeld pflegen, empfinden ihre Tätigkeit oft als überfordernd oder psychisch belastend. Erstmals in Deutschland hat ein Forschungsteam des Uniklinikums Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in einer aktuellen Studie die positiven Seiten nachgewiesen, die mit der Pflegetätigkeit verbunden sind. Den Beitrag über die Forschungsergebnisse unserer Kolleginnen und Kollegen lesen Sie hier.
digiDEM Bayern entwickelt digitale Angebote für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Demenz sowie für pflegende An- und Zugehörige und ehrenamtliche Helfende und stellt die Angebote auf digiDEM-Bayern.de zur Verfügung.
Unser Tipp: Viele Menschen mit Demenz werden daheim in ihrem vertrauten Lebensumfeld gepflegt. Für die pflegenden An- und Zugehörigen bedeutet dies allerdings ein Mehr an Betreuungsaufwand. Denn plötzlich werden für Menschen mit Demenz zum Beispiel Türschwellen zu gefährlichen Stolperfallen oder es können Bilder an der Wand die Desorientierung der Betroffenen verstärken. digiDEM Bayern möchte die pflegenden An- und Zugehörigen entlasten, Maßnahmen zu ihrem eigenen Schutz vorstellen und zur Sicherheit der Betroffenen beitragen. Deshalb kooperieren wir mit der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen und stellen gerne deren kostenfreie Online-Plattform „Sicheres Pflegen zu Hause“ zur Verfügung. Nutzen Sie unser digitales Angebot, das sich als praktischer Ratgeber für den Alltag von Menschen mit Demenz und deren pflegenden An- und Zugehörigen versteht. Hier geht’s zum Portal „Sicheres Pflegen zu Hause“.
Alle Newsletter, die bisher erschienen sind, können Sie auch Nachlesen: Hier geht’s zu unserem Newsletter-Archiv.
Nutzen Sie auch unseren digitalen Fragebogen „digiDEM Bayern DEMAND®“ und empfehlen Sie ihn weiter. Er hilft pflegenden An- und Zugehörigen, die eigenen Versorgungsbedarfe zu erkennen, wenn der Pflegebedarf von Menschen mit Demenz steigt. Hier gelangen Sie zum Fragebogen „digiDEM Bayern DEMAND®“.
Hier geht’s zu den bisherigen Ausgaben unseres Newsletters digiDEM Bayern DIGITAL UPDATE.