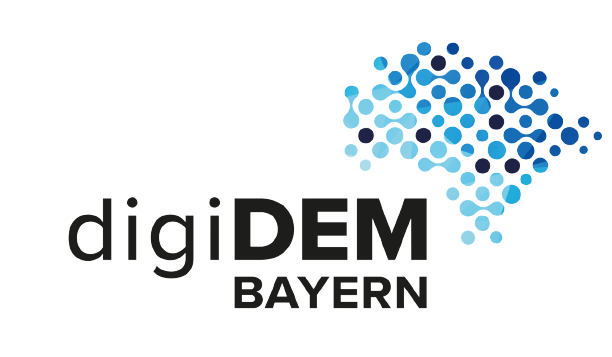digiDEM Bayern schreibt eine Erfolgsgeschichte fort: Mit mehr als 3.000 Teilnehmenden hat das größte Demenzregister Deutschlands einen neuen Höchststand erreicht. Das vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP) geförderte Leuchtturmprojekt zählt damit zugleich zu den größten europäischen Vorhaben zur Erfassung von Langzeitdaten im Bereich der Versorgungsforschung zu Demenzen. Ziel ist es, die Versorgungssituation von Menschen mit Demenz und ihren pflegenden An- und Zugehörigen zu verbessern – unterstützt durch innovative digitale Anwendungen.
Die Zahlen sind eindeutig: „Das Demenzregister ist ein Wissensspeicher von unschätzbarem Wert“, sagt digiDEM Bayern-Projektleiter Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. „Am Ende geht es immer darum, das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Familien spürbar zu verbessern – und dazu kann Digitalisierung einen entscheidenden Beitrag leisten.“ Über 3.000 Teilnehmende, 300 (Stand 01.10.25) Forschungspartner und Projektassistenzen vor Ort in allen bayerischen Regierungsbezirken und Ergebnisse, die unmittelbar in Forschungs- und Versorgungsstrategien einfließen: digiDEM Bayern ist auf Wachstumskurs.

Für das Demenzregister werden Menschen mit leichten kognitiven Einschränkungen ebenso wie Menschen mit Demenz und ihre pflegenden An- und Zugehörigen befragt. „Die freiwilligen Datenspenden der Bürgerinnen und Bürger sind das Fundament unserer Forschung. Die Daten erlauben es uns, den Langzeitverlauf von Demenzerkrankungen wissenschaftlich zu erfassen“, betont Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas.
Der Neurologe unterstreicht die zentrale Rolle der Digitalisierung: „Die digitale Analyse großer Datenmengen eröffnet uns neue Chancen. Moderne Methoden, auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, ergänzen klassische Verfahren und liefern uns wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Versorgung von Menschen mit Demenz und ihren pflegenden An- und Zugehörigen in Bayern. Damit können wir Betroffenen direkt etwas zurückgeben – sei es durch digitale Hilfsmittel oder transparente Informationen.“
Digitale Anwendungen als Brücke zu den Betroffenen
Aus dem Projekt digiDEM Bayern sind bereits digitale Angebote hervorgegangen. Dazu gehört der Fragebogen „digiDEM Bayern DEMAND®“, mit dem pflegende An- und Zugehörige ihren individuellen Unterstützungsbedarf einschätzen können. Solche nutzerfreundlichen Werkzeuge erleichtern den Zugang zu Gesundheitsinformationen und tragen dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und ihren pflegenden An- und Zugehörigen zu steigern.
„Die Entwicklung dieser digitalen Tools ist nur möglich durch die konsequente und qualitativ gesicherte Auswertung unserer erhobenen Daten“, erklärt Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. „So wird die Digitalisierung zu einem echten Motor für Versorgung, Forschung und Prävention.“
Ein weiterer wichtiger Aspekt sei das langfristige digitale Monitoring neuer Alzheimer-Medikamente. „Unser Register erlaubt es uns, die Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen unabhängig und transparent über viele Jahre hinweg zu dokumentieren – ein Beitrag zur Patientensicherheit, der frei von Lobbyinteressen bleibt“, sagt der digiDEM Bayern-Projektleiter.
Politik kann auf Registerforschung setzen
Für Entscheider aus der Gesundheitspolitik sind die validierten Erkenntnisse aus den ausgewerteten Daten von großem Interesse. Denn die Ergebnisse tragen dazu bei, zielgerichtete Maßnahmen für Betroffene zu entwickeln besonders in ländlichen Regionen. Oft mangelt es dort an Unterstützungsangeboten.
So kooperiert digiDEM Bayern bereits mit zahlreichen „Gesundheitsregionenplus“ des Freistaates. Auf kommunaler Kreisebene sind sie ein Kernelement der regionalen Gesundheitsförderung und -versorgung in Bayern. „Die Gesundheitsregionenplus leisten bei der Durchführung unserer Demenz-Screeningtage vorbildliche Arbeit“, erklärt Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. „Bei den Gedächtnistests werden Menschen identifiziert, die aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigungen auf freiwilliger Basis an unserem Forschungsprojekt teilnehmen können. So schließt sich ein Kreis.“
Vom Demenzregister in den Alltag
Register gelten in der medizinischen Forschung als unverzichtbare Instrumente: Sie liefern praxisnahe Daten über Behandlung und Versorgung und decken Versorgungslücken auf. „Mit digiDEM Bayern verstärken wir dieses Wissen – und machen zum Beispiel Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen sichtbar“, so Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. Bereits jetzt liefert das Register wichtige Erkenntnisse.
Erste Ergebnisse zeigen etwa, dass in Bayern qualitativ große Unterschiede in der Diagnostik bestehen: Während in städtischen Gebieten häufiger spezifische Demenzdiagnosen gestellt werden, wird in ländlichen Räumen anteilig häufiger die unspezifische Diagnose einer unspezifischen „nicht näher bezeichneten Demenz“ dokumentiert.
Die digiDEM Bayern-Forschenden fanden auch heraus, dass Menschen mit kognitiven Einschränkungen nach der Demenzdiagnose durchschnittlich 32 Monate in ihrer häuslichen Umgebung leben, bevor ein Pflegeheimeintritt unvermeidlich wird. Eine weitere digiDEM Bayern-Studie weist auf ein hohes Risiko sozialer Isolation bei Menschen mit Demenz hin – insbesondere im Freundeskreis. „Unterstützungsangebote zur Förderung sozialer Teilhabe sollten daher verstärkt im außerfamiliären Bereich ansetzen“, sagt Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas.
Forschungspartner stärken Bedeutung der Demenz-Früherkennung
Dass digiDEM Bayern flächendeckend tätig sein kann, liegt an einem starken Netzwerk. Zahlreiche Forschungspartner – von Beratungsstellen über Kliniken und ambulante Dienste bis hin zu Apotheken, Arztpraxen und ehrenamtlich Engagierten – beteiligen sich an der Datenerhebung. „Ihnen gilt unser großer Dank“, sagt Kolominsky-Rabas. „Sie verleihen Betroffenen vor Ort eine Stimme, machen Demenzforschung nahbar und sensibilisieren in ihrer Region für die Bedeutung der Demenz-Früherkennung.“ Das Netzwerk zeige, wie sehr es lokalen Akteuren am Herzen liegt, Menschen mit Demenz in die Mitte der Gesellschaft einzubinden.
Europäische Perspektive als Zukunftschance
Über Bayern hinaus denkt das Projekt längst europäisch. Mit dem geplanten „European Health Data Space“ (EHDS) will die EU Gesundheitsdaten über Ländergrenzen hinweg nutzbar machen. Für Register wie digiDEM Bayern eröffnen sich dadurch neue Chancen: Gemeinsame Analysen über nationale Datensätze hinweg könnten regionale länderübergreifende Unterschiede in Prävention und Versorgung sichtbar machen und Innovationen beschleunigen.
„Das Potenzial des europäischen Datenaustauschs ist riesig“, betont Prof. Dr. Peter Kolominsky-Rabas. „Wir können voneinander lernen und effektivere Lösungen für die Menschen entwickeln – nicht nur in Bayern, sondern in ganz Europa.“