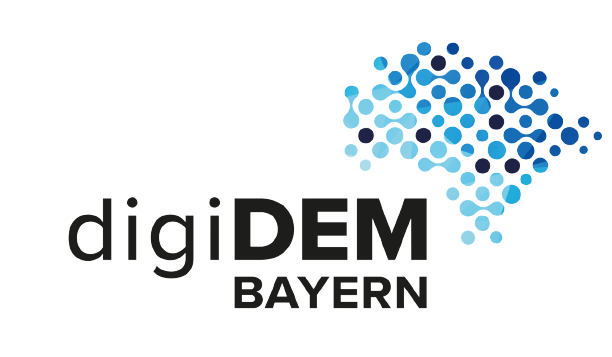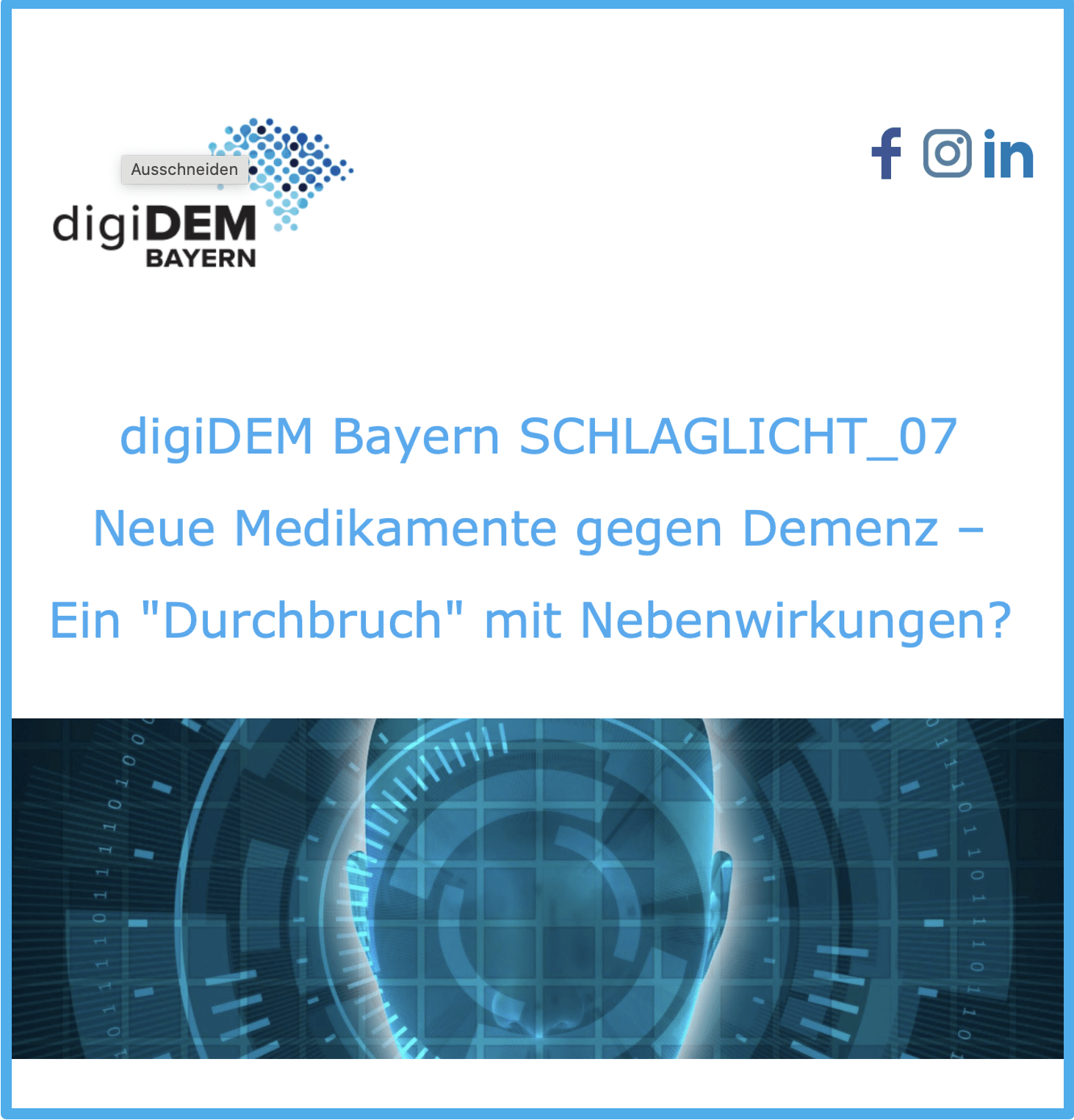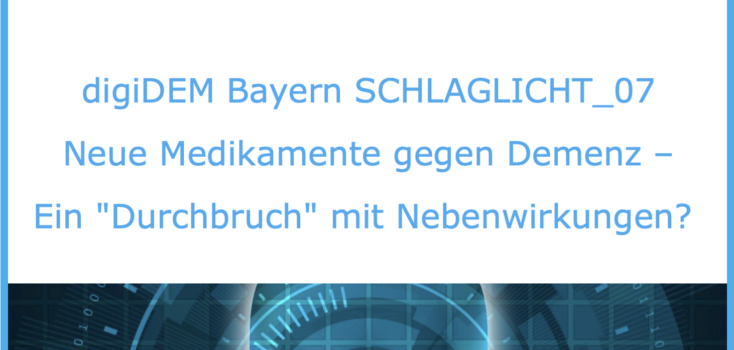In den vergangenen Wochen haben wir Sie in mehreren Teilen unseres Sonder-Newsletters SCHLAGLICHT – Medikamente gegen Demenz über neue Demenz-Medikamente und Herausforderungen für die Alltagsversorgung informiert. Alle Ausgaben, die erschienen sind, können Sie jederzeit in unserem digiDEM Bayern-Newsletterarchiv nachlesen: https://digidem-bayern.de/newsletter-archiv/.
In der siebten und letzten Ausgabe unseres Sonder-Newsletters SCHLAGLICHT – Medikamente gegen Demenz befasst sich Michael Zeiler, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei digiDEM Bayern, mit der Veröffentlichung „Lecanemab for Alzheimer’s disease“ von Sebastian Walsh von der University of Cambridge und einer internationalen Autorengruppe in der Fachzeitschrift BMJ über die Wirkung und Nebenwirkungen des Medikamentes Lecanemab (DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.o3010).
Lesen Sie jetzt den Beitrag von Michael Zeiler:
Lecanemab: Ein Durchbruch in der Alzheimer-Therapie?
Die veröffentlichten Ergebnisse der Phase-3-Studie zu Lecanemab, einem neuen Antikörpermedikament gegen Alzheimer, haben in der medizinischen Gemeinschaft und in den Medien für Aufsehen gesorgt. Mit Berichten über eine „neue Ära der Alzheimer-Behandlung“ wurde das Medikament als potenzieller Durchbruch gefeiert. Doch bei genauer Betrachtung stellt sich die Frage, ob Lecanemab tatsächlich die erhoffte Wirkung auf den Krankheitsverlauf hat und ob die damit verbundenen Risiken vertretbar sind.
Wirksame Amyloid-Reduktion – aber nur minimaler Nutzen
Im Gegensatz zu früheren medikamentösen Therapien zeigte die Lecanemab-Studie einen statistisch signifikanten Unterschied in der Verlangsamung des kognitiven Verfalls bei Alzheimer-Patienten. Dennoch bleibt der tatsächliche klinische Nutzen fraglich. Die erzielte Verbesserung der Kognition auf einer Skala von 0 (= gesund) bis 18 (= schwere Demenz) war minimal (0,35 bis 0,62 Punkte nach 18 Monaten Behandlung) und lag deutlich unter dem, was für die klinische Praxis von Bedeutung (0,98 – 1,63) angesehen wird. Die Behandlung bietet daher für Patientinnen und Patienten und ihre Familien keine wahrnehmbare klinische Verbesserung.
Erhebliche Sicherheitsbedenken
Neben dem begrenzten Nutzen wirft Lecanemab auch erhebliche Sicherheitsbedenken auf. Während der klinischen Studie entwickelten über 12% der Teilnehmenden Hirnödeme und etwa 17% erlitten asymptomatische Hirnblutungen. Beide Nebenwirkungen können lebensbedrohlich sein und treten deutlich häufiger auf als in der Vergleichsgruppe (1,7% und 9,0%), die das Medikament nicht erhalten hat. Diese Zahlen sind, so Sebastian Walsh und Kollegen, besorgniserregend, insbesondere da die langfristigen Auswirkungen dieser Nebenwirkungen noch unklar sind. Zudem mussten fast 7% der Teilnehmenden die Studie aufgrund schwerwiegender Nebenwirkungen abbrechen.
Ein „Gamechanger“?
Die US-amerikanische Zulassungsbehörde (FDA) hat Lecanemab bereits im Jahr 2023 zugelassen, die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte einer Zulassung zunächst auf Grund des fehlenden Nachweises der klinisch relevanten Verbesserung nicht zugestimmt. Am 14. November sprach der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA nach einem erneuten Prüfverfahren die Empfehlung aus, Lecanemab unter Auflagen verordnen zu können. Das Medikament ist ausschließlich für Patienten mit einer frühen Form der Alzheimer-Erkrankung zugelassen, bei denen zudem Beta-Amyloid-Proteine, also punktförmige Eiweißablagerungen im Gehirn, nachgewiesen wurden. Es sollte außerdem nur an Personen verabreicht werden, die entweder keine oder höchstens eine genetische Kopie des Apolipoprotein E (ApoE4)-Proteins aufweisen (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/leqembi).
Sebastian Walsh und Kollegen äußern insgesamt erhebliche Zweifel daran, ob Lecanemab wirklich den erhofften „Gamechanger“ darstellt. Angesichts der begrenzten Wirksamkeit und der erheblichen Risiken von Lecanemab ist es unerlässlich, dass die Forschung sich breiter aufstellt. Die Reduktion von Demenzrisiken durch Präventionsmaßnahmen, die Erforschung alternativer therapeutischer Ansätze und die Förderung nicht-pharmakologischer Interventionen mit nachgewiesenen Vorteilen sollten verstärkt in den Fokus rücken, fassen Walsh und Kollegen zusammen.