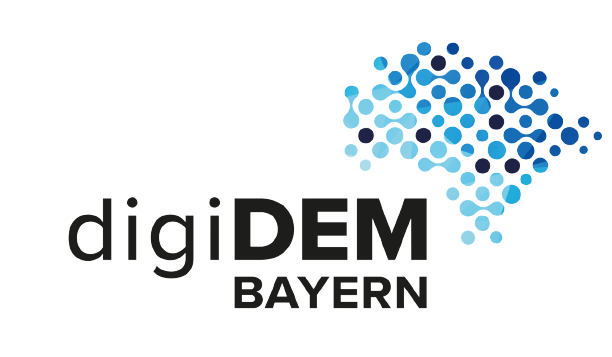Das Thema Gendiagnostik rückt immer stärker in den Fokus – besonders, wenn es um Erkrankungen wie Demenz geht, bei denen auch die genetische Veranlagung eine Rolle spielen kann. Doch was genau steckt hinter einem Gentest? Wann ist er bei einer Demenz sinnvoll? Und wie geht man mit den Ergebnissen um?
Unter Gendiagnostik versteht man grundsätzlich die Untersuchung des Erbguts, um Hinweise auf genetische Veränderungen zu finden. Diese Tests können dabei helfen, Veranlagungen für bestimmte Krankheiten aufzudecken – oder die Ursachen bereits aufgetretener Symptome besser einzuordnen. Dabei wird meist eine Blut- oder Speichelprobe analysiert. Im Zusammenhang mit der Alzheimer-Demenz und anderen Demenzformen wird bei genetischen Untersuchungen nach Abweichungen in Genen gesucht, die eine Anhäufung von schädlichen Proteinen im Gehirn verursachen. Diese können direkt oder indirekt mit dem Entstehen der Erkrankung in Verbindung stehen.

Wann können Gentests sinnvoll sein?
Auch wenn ein genetischer Befund Hinweise auf ein erhöhtes Risiko oder eine bestimmte Ursache geben kann, ist die Aussagekraft der Tests begrenzt. Ein auffälliger Befund bedeutet nicht zwangsläufig die Entwicklung einer Krankheit. Umgekehrt garantiert ein unauffälliger Test nicht, dass man sicher verschont bleibt. Besonders belastend kann das Wissen um eine genetische Veranlagung sein, wenn es keine Heilung gibt – wie bei der Alzheimer-Demenz.
Allgemein unterscheidet man bei der Demenz zwischen zwei Arten genetischer Tests: So gibt es die Testung auf sogenannte Ursachen-Gene, wie APP, PSEN1 oder PSEN2, deren Veränderungen direkt mit der erblichen, bzw. familiären Form von Alzheimer-Demenz verbunden sein können. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel Familiäre Alzheimer-Demenz: Seltene Genmutationen als Ursache. Daneben existieren auch Testungen auf sogenannte Risiko-Gene, wie das ApoE4-Gen, das das Erkrankungsrisiko erhöhen kann – ohne jedoch eine Erkrankung sicher vorherzusagen. Darüber erfahren Sie mehr in unserem Beitrag Das ApoE-Gen – ein genetischer Risikofaktor für Alzheimer.
Die Sinnhaftigkeit dieser Gentests haben die Autorinnen und Autoren der S3-Leitlinie Demenzen genauer betrachtet. Die Fachexperten empfehlen die Testung auf die Ursachen-Gene unter der Voraussetzung, dass ein Verdacht auf die familiäre Form besteht. Von einer Testung auf Risiko-Gene wird hingegen klar abgeraten.
Beratung ist Pflicht – und Schutz zugleich
Um Betroffene vor vorschnellen oder belastenden Entscheidungen zu schützen, ist eine ausführliche genetische Beratung in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Das sogenannte Gendiagnostikgesetz regelt genau, unter welchen Bedingungen genetische Untersuchungen erlaubt sind und schreibt vor, dass Betroffene vor und nach der Untersuchung über Chancen und Risiken aufgeklärt werden. Vor allem bei prädiktiven Tests – also solchen, die Aussagen über ein zukünftiges Erkrankungsrisiko machen – ist eine fundierte Aufklärung entscheidend. Jede und jeder hat dabei außerdem das Recht, die eigenen genetischen Befunde zu kennen (Recht auf Wissen), aber auch das Recht, diese nicht zu kennen (Recht auf Nichtwissen). Mehr zum Recht auf Wissen und Nichtwissen können Sie in unserem Webinar „Das Recht auf (Nicht-) Wissen einer Demenzdiagnose aus medizinischer Sicht“ erfahren.
Wer kann sich testen lassen – und wo?
Genetische Tests werden bei Demenz vor allem dann eingesetzt, wenn der Verdacht auf eine familiäre Form der Alzheimer-Demenz besteht. Dieser Verdacht besteht vor allem bei einem sehr frühen Krankheitsbeginn (unter 65 Jahren) oder bei direkten Angehörigen von bereits erkrankten Personen. Das heißt, dass sich Geschwister und Kinder (ab dem 18. Lebensjahr) testen lassen können, wenn ein direktes Familienmitglied an der familiären Form der Demenz erkrankt ist – auch wenn sie selbst noch keine Symptome zeigen.Eine genetische Testung sollte immer über spezialisierte Fachärztinnen und Fachärzte für Humangenetik erfolgen. In vielen Städten gibt es genetische Beratungsstellen oder Ambulanzen, die eine solche Untersuchung anbieten – eine Übersicht finden Sie hier bei der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e.V. (GFHEV). Bei medizinischer Indikation bzw. einem Verdacht werden die Kosten für die Testung auf Ursachen-Gene in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Testung auf Risiko-Gene wie ApoE4 wird auch über kommerzielle Anbieter angeboten. Hier ist jedoch die Kostenerstattung durch Krankenkassen nicht sicher gegeben.
Wissen ist Macht – aber auch Verantwortung
Ein Gentest kann wertvolle Hinweise geben, besonders wenn es darum geht, eine seltene erbliche Form von Alzheimer-Demenz zu erkennen. Doch mit diesem Wissen geht auch Verantwortung einher – für sich selbst und für die Familie. Deshalb gilt: Lassen Sie sich gut beraten, wägen Sie Nutzen und Belastung sorgfältig ab, und entscheiden Sie bewusst.
Quellen:
Alzheimer Forschung Initiative e.V. (2025): Gentest zur Feststellung von Alzheimer-Demenz.
Bundesministerium für Gesundheit (2016): Gendiagnostikgesetz.
DGN e. V. & DGPPN e. V. (Hrsg.) S3-Leitlinie Demenzen, Version 5.1, 28.03.2025.