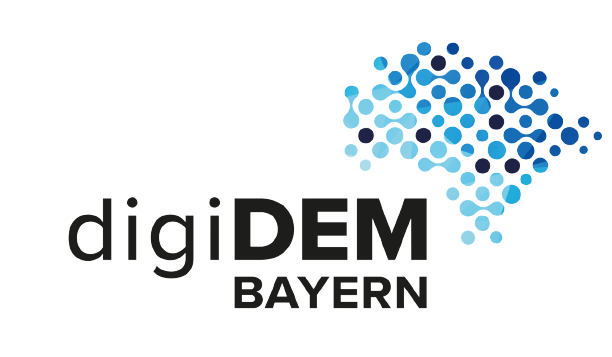Hauke Dressler, 56, arbeitet für Magazine wie GEO und STERN, fotografiert Imagekampagnen und Portraits und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. 2013 erkrankte sein Vater Fritz Dressler, ein Architekt, Hochschul-Professor und erfolgreicher Fotograf, an Alzheimer-Demenz. 2017 unternahmen Vater und Sohn eine gemeinsame „letzte Reise“ nach Finnland. Für die Veröffentlichung im „Walden“-Magazin von GEO wurde Hauke Dressler 2018 in der Kategorie „Beste Foto-Reportage“ für den renommierten Henri-Nannen-Preis nominiert. Bei Desideria Care e.V. ist er Botschafter des Projektes „Demenz Neu Sehen“. Im Interview spricht Ilona Hörath mit ihm über gute Fotografie, eine besondere Holzhütte in Lappland und bewegende Momente einer abenteuerlichen Reise.
Herr Dressler, was macht für Sie ein gutes Bild aus und was bedeutet Fotografie für Sie?

Fotografie bedeutet für mich über Themen zu lernen und berichten zu können, für die ich mich interessiere. Für gute Bilder braucht es Zugang, Offenheit und Auseinandersetzung. Neue Perspektiven müssen entstehen, die Fotografierte und Betrachter interessieren. Wenn die Menschen merken, dass ich mich wirklich für sie interessiere, entsteht Vertrauen. Das ist der Zugang, der später zusammen mit Perspektive und Ästhetik darüber entscheidet, ob ein Foto Wirkung entfaltet. Für mich ist Fotografie bereichernd und ich lerne ständig dazu. Wenn es gelingt, ein neues Bild zu schaffen, das den Betrachter berührt, und in Erinnerung bleibt, dann ist es ein gutes Bild. Anfangs wollte ich reisen, und die Fotografie ermöglichte mir das Unterwegssein. Inzwischen lege ich in meiner Arbeit einen für mich wichtigen Schwerpunkt auf die Fotografie von Erkrankten und ihren Angehörigen.
Galt dies auch schon für das Thema Demenz und für die Fotos, die Sie von Ihrem Vater gemacht haben?
Ja, ich glaube schon. Ich wollte meinen Vater neu sehen. Die Wirkung einer guten Fotografie im Bereich Demenz liegt darin, dass ein Gefühl gezeigt wird. Denn das Bewahren eines Gefühls schafft Erinnerung. Eine Fotografie ist immer auch ein Mittel gegen das Vergessen.
Sie haben mit Ihrem an Demenz erkrankten Vater eine „letzte gemeinsame Reise“ unternommen – nach Lappland, an Orte, die ihr Vater mochte. Warum fuhren Sie mit ihm in einem Geländewagen 2500 Kilometer durch Eis und Schnee bis an den Polarkreis?
Ich wollte versuchen an gemeinsame Erinnerungen anzuknüpfen. Den wichtigsten Ort seines Lebens noch mal gemeinsam besuchen, um zu schauen, ob in seinem Gedächtnis noch Spuren davon zu finden sind. Vielleicht war es auch die Sehnsucht nach meinem Vater, wie ich ihn als Kind erlebt hatte. Als ich meinen Vater im Winter 2017 gefragt habe, ob wir die Reise gemeinsam unternehmen wollen, waren die Diebesbanden in seinem Kopf bereits einige Jahre unterwegs.

Foto: Hauke Dressler
Fand die Reise aus Ihrer Sicht zum richtigen Zeitpunkt statt?
Wohl schon. Aber schwer zu sagen, ob es den gibt. Der Hausarzt meines damals 80-Jährigen Vaters riet es zu tun: „Pack ihn warm ein, und gib ihm ordentlich zu trinken“. Hätten wir die die Reise früher unternommen, hätte er sich gegen die Strapaze der Winterreise gewehrt und wäre in sein altes Ich gefallen, das sagt, wo es lang geht. Hätte die Reise zu einem späteren Zeitpunkt stattgefunden, wäre sie unter Umständen gescheitert.
Das Verhältnis zu ihrem Vater beschrieben Sie selbst einmal als nicht einfach, als voneinander entfremdet. Hat sich dies während der Reise geändert?
Das distanzierte Verhältnis rührte aus einer Zeit, in der meine Eltern ihre Probleme nicht in den Griff bekommen haben. Ich war früh auf mich allein gestellt. Dennoch hatte mir mein Vater das Reisen gezeigt und mir seine Begeisterung nahegebracht. Als 15-, 16-Jähriger war ich sein Fotoassistent in Indien und anderen Ländern, in die wir fuhren. Mein Vater hat eine Welt fotografiert, die es so nicht mehr gibt. Ich war neugierig und bewunderte meinen Vater. Er war wie ein Geschichtenerzähler. In der Verkehrung dessen ist die Reise nach Lappland entstanden, die sozialen Rollen zwischen ihm und mir haben sich umgekehrt. Nur war ich es jetzt, der die Verantwortung für ihn übernehmen musste.
Eines Ihrer Reiseziele war eine besondere Blockhütte irgendwo im Wald in Lappland.
Die Holzhütte hatte für meinen Vater eine große Bedeutung. In den 1960-er Jahren hatte er als Architekturstudent, mit Freunden für 1.000 D-Mark eine Halbinsel nahe Rovaniemi in Finnisch-Lappland gekauft. Darauf errichteten sie ein Blockhaus, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung. Das war eine Art Abenteuerspielplatz für die jungen Hipster. Dorthin ist meine Familie jahrzehntelang immer wieder gefahren, wir haben dort zahlreiche Sommer in meiner Jugend verbracht.

Was passierte, als sie beide bei der Blockhütte angekommen sind?
Die Hütte liegt einsam und die Zuwegung war verschneit, wir mussten durch tiefen Schnee stapfen. Für meinen Vater war das Haus nichts Besonderes. Er hat keine Form von Erinnerung gezeigt und nur gesagt: „Hier war ich schon einmal“. Das war sein einziges Gefühl für einen Platz, den er über Jahrzehnte so geliebt hat. Er konnte es nicht mehr einordnen.
Wie empfanden Sie die Zeit mit Ihrem Vater?
Im Nachhinein betrachtet, habe ich mich mit unglaublicher Naivität und Ungestümheit auf eine abenteuerliche Reise eingelassen. Ich habe ihn 24 Stunden am Tag erlebt, und musste mich kümmern. Die Krankheit meines Vaters war fortgeschrittener, als ich gedacht hatte. Er liebte immer noch das Autofahren, das Unterwegssein, sagte aber auf der Reise schnell: „Ich will nach Hause.“ Da kann man nicht sagen: „Wir sind bald da“, das funktioniert nicht. Bei Demenzkranken bedeutet das Nach-Hause-Wollen: Ich will zu mir selbst.
An welche persönlichen Grenzen sind Sie während der Reise gestoßen?
Ich musste mein Tempo verringern, weniger weit fahren, mich auf ihn einlassen. Als Sohn – und jüngerer Mensch verweigert man sich da erstmal. Aber ich habe realisiert, entweder ich lasse mich auf meinen Vater ein und erzeuge mehr Entspannung oder es funktioniert nicht. Bei Demenz sind die Vergangenheit und die Zukunft hinfällig. Denn es geht nicht um das, wozu mein Vater nicht mehr in der Lage war, sondern um das, was noch möglich ist. Unser Spielraum ist allein die Gegenwart.

Was war bei Ihrem Vater noch möglich?
Er liebte und handhabte seine Kamera immer noch intuitiv und fast reflexartig wie ein Profifotograf. Es ist ihm gelungen noch zu fotografieren, was ihn ansprach: starke Kontraste von Licht und Schatten, Birken oder die typischen Häuser im Schnee. Nach einer Minute hatte er es allerdings vergessen und fotografierte das Motiv wieder und wieder. Ich habe es beobachtet und fotografierte ihn in den Momenten, in denen er fotografierte.
War die große Reise nicht zu strapaziös und kräftezehrend?
Die Reise war eine ungemeine Strapaze, was ich unterschätzt hatte. Unsere Anstrengung wuchs von Tag zu Tag durch Schlaflosigkeit, die durch seine Unruhe entstand. Nachts wusste er nicht, wo er ist, suchte die Lichtschalter oder die Toilette. Das nicht mehr funktionierende Gehirn ist ein Unruheherd.
Wie wichtig war der eine, bestimmte Moment, um Ihren Vater zu fotografieren? Was brauchte es dafür?
Es bedurfte meiner ganzen Lebenserfahrung, der als Sohn, und auch der als Vater zweier Töchter. Vielleicht kann man sagen, dass ich 48 Jahre und eine 1/125 Sekunde brauchte (Belichtungszeit, Anm. d. Red.), um ihn jetzt so sehen zu können. Ich musste zuerst eine Situation schaffen, in der wir beide etwas erlebten. Auf der Reise entstanden die Bilder, aber erst nach Stunden und Tagen. Den Zugang zu ihm erreichte ich also über die Zeit und darüber, dass ich mich auf ihn einließ.
Würden Sie bitte ihren emotionalsten Moment auf der Reise beschreiben?
Das war wohl der Moment der Einsicht, dass ich ihn überlaste. Eines Morgens, an Tag zehn unserer Reise, hätten wir uns fast geprügelt. Ich hatte ihn gebeten, seine nasse Hose zu wechseln. Er schrie „Das mach‘ ich nicht“ und erhob die Hand gegen mich. Das war ein Wendepunkt. Ich zog mich zurück, und sagte zu ihm „Okay, jetzt erst mal schlafen“ und nach einer halben Stunde war alles wieder gut. Ich dachte, ich bin zu weit gegangen und das am letzten Tag vor der Ankunft an der Hütte. Mir wurde klar, dass es so nicht weitergeht und ich ihn in ein Flugzeug setzen müsste, um ihm die anstrengende Rückreise zu ersparen. Auch ein Wagnis, ihn allein fliegen zu lassen, aber mit Hilfe deutscher Touristen ist es gelungen.

Nicht jeder kann sich eine solche große Reise leisten. Welchen Tipp haben Sie? Worauf sollten pflegende Angehörige achten?
Die gemeinsame Zeit ist im Nachhinein unbezahlbar. Man sollte im Rahmen der eigenen Möglichkeiten versuchen, etwas Gemeinsames zu machen: Weil die Erkrankten gehen, und man selbst übrigbleibt. Die eigene Überwindung ist dabei die größte Hürde, und auch keine Zeit oder keine finanziellen Ressourcen zu haben. Eine Reise mit dem Menschen, der an Demenz erkrankt ist, kann auch an einen Ort in der Nähe führen, der einmal wichtig war. Dabei die eigenen Grenzen zu überschreiten wird zum Schlüssel für die eigene Auseinandersetzung. Es geht bei so einer Reise nicht um Urlaub, sondern um das Erlebte.
Sie haben unzählige Bilder gemacht. Welches ist das Foto, das sie selbst am meisten berührt?
Das „Eisblumenbild“ ist für mich die Illustration der Vergänglichkeit, das ist ein wichtiges Bild und es bedeutet mir sehr viel. Das Wertvollste ist aber ein eher profanes Selfiefoto. Es zeigt meinen Vater und mich sehr direkt nebeneinander und versinnbildlicht unsere Ähnlichkeiten und zeigt mir, wer wir zusammen waren.
Was bedeuten Ihnen die Bilder von der Reise mit Ihrem Vater?
Diese Bilder sind jetzt die Möglichkeit mich zu erinnern, ich erinnere den Mut, den ich hatte, auf diese Reise zu gehen, ich erinnere meine damalige Unerfahrenheit. Sie sind der Beginn und die Illustration einer Auseinandersetzung. Ich konnte mit ihm Frieden schließen. Nach der Reise lebte mein Vater noch drei Jahre. Auch in dieser Zeit habe ich ihn fotografisch begleitet, war seine wichtigste Bezugsperson. Er hat sich in mir wiedererkannt. Nach der Reise habe ich die Entscheidung getroffen, die in ihm Freude ausgelöst hat, das habe ich gespürt: Ab jetzt nenne ich ihn wieder Papi.
Herr Dressler, herzlichen Dank für das Gespräch.