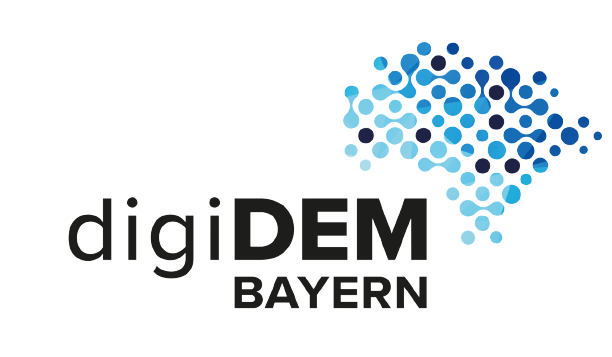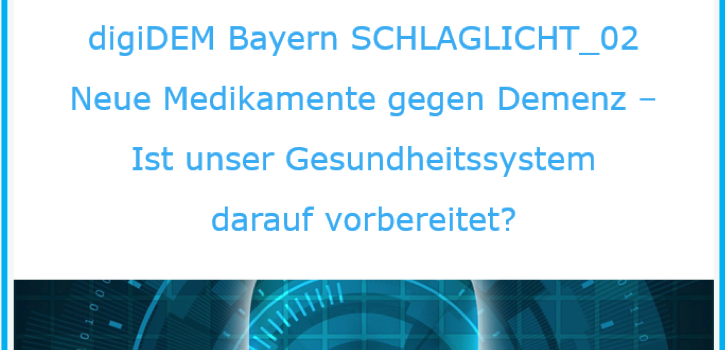In zweiten Teil unseres neuen Sonder-Newsletters SCHLAGLICHT – Neue Medikamente gegen Demenz befasst sich Jana Rühl, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei digiDEM Bayern, mit der Veröffentlichung des Forschungsteams um Professor Sören Mattke von der University of Southern California.
Heute geht es um die Frage, ob die Gesundheitssysteme die diagnostischen Anforderungen überhaupt bewältigen können, die sich durch die in die Versorgung kommenden Medikamente gegen Alzheimer ergeben (DOI: 10.14283/jpad.2023.94).
Lesen Sie jetzt den Beitrag von Jana Rühl:
Neue Medikamente gegen Demenz: Ist unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet?
Die Zulassung der ersten monoklonalen Antikörper, wie Lecanemab und Donanemab, durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Doch die Freude über diesen möglichen Durchbruch ist getrübt. Denn neben Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamente steht bei einer Zulassung die Frage im Raum: Ist unser Gesundheitssystem organisatorisch bereit für die neuen Medikamente?
Spezialisierte Experten und komplexe Diagnostik notwendig
Die neuen Medikamente gegen Alzheimer, wie Lecanemab oder Donanemab, versprechen, den Krankheitsverlauf im sehr frühen Stadium der Erkrankung zu verlangsamen. Aber nicht alle Patienten und Patientinnen können gleichermaßen von ihnen profitieren. Denn es kommt nur eine ganz bestimmte Gruppe der Erkrankten für die Behandlung in Frage. Um diese Erkrankten sicher zu identifizieren, bedarf es einer komplexen Diagnostik mit mehrfachen Untersuchungen des Gehirns mit Kernspintomographie, Untersuchungen des Blutes und der Entnahme von Gehirnwasser (Liquor). Eine frühzeitige und differenzierte Diagnostik durch spezialisierte Fachärzte ist deshalb unabdingbar, um die für die Therapie geeigneten Patientinnen und Patienten rechtzeitig zu identifizieren. Doch sind dafür bislang weder die notwendigen Strukturen noch ausreichende Kapazitäten vorhanden.
Engpässe in der Versorgung und lange Wartezeiten
Ein Blick nach Schweden, einem Vorreiter in der Demenzversorgung, zeigt die Brisanz der Situation. Den Berechnungen von Prof. Sören Mattke und Kollegen zu Folge reichen dort die derzeitigen diagnostischen Kapazitäten bei Weitem nicht aus, um geeignete Patientinnen und Patienten zeitgerecht für die Behandlung zu diagnostizieren. So würde die Wartezeit von Betroffenen in Schweden – bei gleichbleibender Behandlungskapazität – von 21 Monaten im Jahr 2023 auf über 50 Monate im Jahr 2028 ansteigen und sich damit mehr als verdoppeln. Ursächlich für die langen Wartezeiten sei laut der Autorengruppe insbesondere der Mangel an Fachärzten. Um eine zeitgerechte Diagnosestellung innerhalb von sechs Monaten zu ermöglichen, müssten zusätzlich rund 25% mehr spezialisierte Neurologen, Geriater und Psychiater zur Verfügung stehen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren wären dazu jährliche Investitionen von rund 81 Millionen Euro notwendig. Zusätzlich würde die vermehrte Nutzung von Biomarker-Tests Kosten von weiteren 11 Mio. Euro verursachen.
Ein ähnliches Szenario dürfte sich auch für Deutschland abzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass nur ein Bruchteil der geeigneten Patientinnen und Patienten profitieren würde, da die Mehrheit von ihnen nicht rechtzeitig nach den erforderlichen Kriterien diagnostiziert werden kann. Hintergrund hierfür sind die langen Ausbildungszeiten, die Überalterung der Ärzteschaft und ein sich abzeichnender Mangel an Fachärzten, insbesondere an spezialisierten Neurologen, Geriatern und Psychiatern.
Mattke, S., Gustavsson, A., Jacobs, L., Kern, S., Palmqvist, S., Eriksdotter, M., Skoog, I., Winblad, B., Wimo, A., & Jönsson, L. (2024). Estimates of Current Capacity for Diagnosing Alzheimer’s Disease in Sweden and the Need to Expand Specialist Numbers. The journal of prevention of Alzheimer’s disease, 11(1), 155–161.