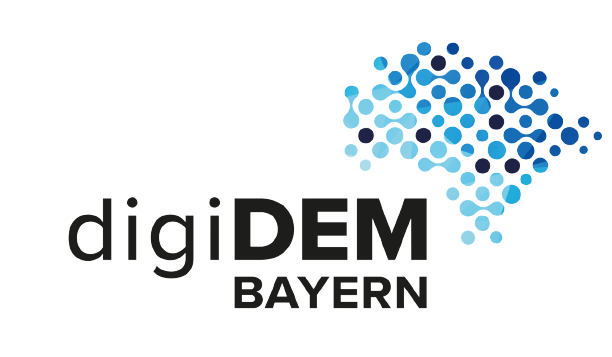Hintergrund: Demenzdiagnosen werden häufig erst bei fortgeschrittener Symptomatik gestellt. Diese bilden jedoch die Grundlage für die Planung und Koordinierung der Behandlungs- und Versorgungsleistungen der Betroffenen sowie die Unterstützungsleistungen für deren pflegende An- und Zugehörige.
Fragestellung: Das Ziel dieser Analyse ist es daher potenzielle soziodemografische Einflussfaktoren auf die Diagnosestellung einer kognitiven Gedächtnisbeeinträchtigung zu identifizieren. Dabei wird die Hypothese getroffen, dass Menschen, die weniger fortgeschrittene Gedächtnisbeeinträchtigungen haben, sozial isolierter leben oder einen erschwerten räumlichen Zugang zu diagnostizierenden Einrichtungen haben häufig keine formale Demenzdiagnose erhalten.
Methode: Datengrundlage ist die multizentrische, prospektive Registerstudie ‚Digitales Demenzregister Bayern – digiDEM Bayern‘. In der Arbeit werden statistische Auswertungen von soziodemografischen Daten und diagnosespezifische Daten von Menschen mit Demenz und Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen (MCI) durchgeführt. Der Wohnort wird nach der Raumabgrenzung Raumtypen 2010 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) einer der drei Kategorien: „überwiegend städtisch“, „teilweise städtisch“ und „ländlich“ zugeordnet.
Implikationen für Versorgung: Die Diagnose ist die Grundlage für die Behandlungs- und Unterstützungsleistung. Deshalb erscheint es wichtig, dass neben den betroffenen Personen auch deren Umfeld dafür sensibilisiert wird. Zusätzlich sollte auch ein besserer Zugang zu diagnostizierenden Einrichtungen ermöglicht werden
2023-09-27_DKVF_MZE-1Vortrag vorgestellt auf dem 22. Deutschen Kongress der Versorgungsforschung am 05.10.2025
Michael Zeiler