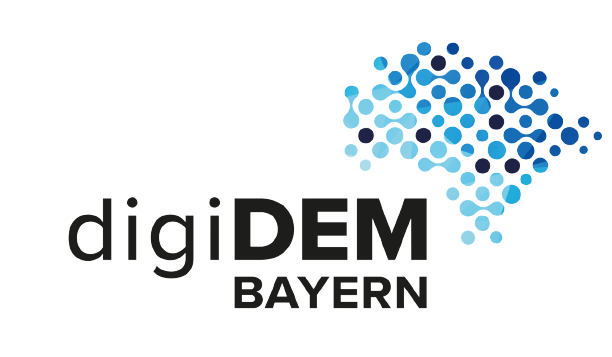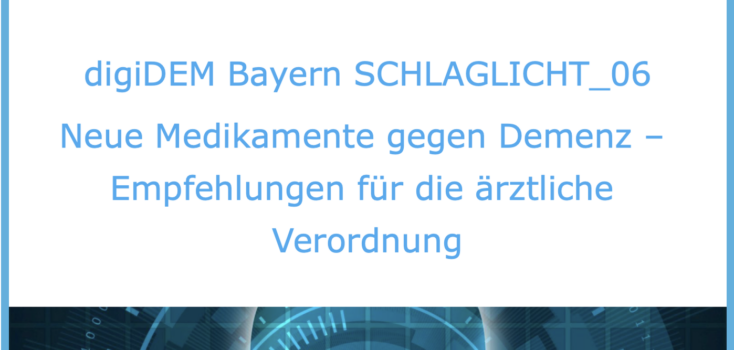In der sechsten Ausgabe unseres Sonder-Newsletters SCHLAGLICHT – Neue Medikamente gegen Demenz befasst sich Lisa Laininger, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei digiDEM Bayern, mit der Veröffentlichung von Dr. Jeffrey L. Cummings von der University of Nevada Las Vegas und Kollegen, die unter dem Titel Lecanemab: Appropriate Use Recommendations in der Fachzeitschrift The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease erschienen ist und die Entwicklung von Empfehlungen für die Verordnung des Medikaments Lecanemab thematisiert (DOI: 10.14283/jpad.2023.30).
Lesen Sie jetzt den Beitrag von Lisa Laininger:
Lecanemab wurde im Juli 2023 in den USA zugelassen. Mehr als ein Jahr später, am 14. November 2024, hat der Europäische Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) den Wirkstoff für eine Behandlung von leichten kognitiven Beeinträchtigungen oder der Alzheimer-Demenz in einem frühen Stadium empfohlen. Allerdings ist die Freigabe mit Einschränkungen verbunden. Lecanemab darf nur Patienten mit einer Alzheimer-Erkrankung im frühen Stadium verschrieben werden, bei denen auch fleckförmige Einweißablagerungen im Gehirn – die sogenannten Beta-Amyloid-Proteine – nachgewiesen wurden. Zudem sollten lediglich Personen, die eine oder keine genetische Kopie des Proteins Apolipoprotein E (ApoE4) vorliegen haben, das Medikament verabreicht bekommen (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/leqembi).
Notwendige Empfehlungen für den Einsatz von Lecanemab
In den USA ist Lecanemab (Markenname Leqembi®) als monoklonaler Anti-Amyloid-Antikörper für die Behandlung von Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen (MCI) und Alzheimer-Demenz im frühen Stadium seit 06.07.2023 zugelassen. Medizinern mangelt es noch an Erfahrung bei der Verordnung des Medikaments, schreiben Cummings und seine Kollegen. Damit die sichere Weitergabe an Patienten in der Praxis gelingen kann, sieht die Forschergruppe um Dr. Cummings die Entwicklung von Empfehlungen für Kliniker als notwendig an. Im Fokus steht dabei die Einhaltung strenger Auswahlkriterien für mögliche Nutzer, eine engmaschige Nachkontrolle sowie die Kommunikation mit den Patienten und deren Angehörigen über Nutzen und Risiken des Medikaments.
Strenge Kriterien bei der Verschreibung notwendig
Zwar wurde die Wirksamkeit von Lecanemab in klinischen Studien nachgewiesen. Aufgrund der Gefahr des Auftretens von Nebenwirkungen wie zum Beispiel Infusionsreaktionen und amyloidbedingten Bildgebungsanomalien (ARIA) sind bestimmte Personengruppen nicht für die Verordnung geeignet. Menschen, die bereits gerinnungshemmende Medikamente einnehmen oder Träger des Gens APOE4 sind, sind besonders anfällig für ARIAs. Zudem wurde das Medikament nur an einer eingeschränkten Studienpopulation getestet, was die Zielgruppe weiter einschränkt. Für Patienten mit anderen Demenzformen, Depressionen, nach Schlaganfall oder BMI größer 35 oder unter 17 kg/m² wird Lecanemab nicht empfohlen. Dies gilt es von medizinischer Seite aus bei der Verschreibung zu beachten.
Umfangreiche Kontrollen empfohlen
Da das Risiko für Nebenwirkungen bei bestimmten Zusatzerkrankungen steigt, empfehlen die Forschenden eine gründliche Anamnese und engmaschige Begleitung der Therapie. Neben grundlegenden diagnostischen Verfahren raten sie zudem zu einer APOE4-Genotypisierung. Während der Behandlung mit Lecanemab sollten darüber hinaus regelmäßige MRT-Scans durchgeführt werden, um mögliche Komplikationen frühzeitig zu entdecken. Dies ist nicht nur mit einem höheren Aufwand und Mitarbeit bei der Therapie auf Seiten der Patienten und deren pflegenden An- und Zugehörigen verbunden. Der Mehraufwand schlägt sich auch auf Ärzte und Ärztinnen nieder. Für die Überwachung der schwerwiegenden Nebenwirkungen werden weitere medizinische Kapazitäten benötigt, beispielsweise für die Entnahme von Gehirnwasser (Lumbalpunktion) und bildgebende Untersuchungen wie Kernspintomografien und Positronen-Emissionstomographien.
Kommunikation zwischen Arzt, Patienten und Angehörigen ist entscheidend
Die Behandlung mit Lecanemab geht für alle Beteiligten mit einem deutlich erhöhten Aufwand in Bezug auf Verabreichung und Kontrolluntersuchungen einher. Auf Patientenseite ist zudem mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen zu rechnen. Daher ist eine allumfassende Aufklärung seitens der Ärzte entscheidend. Nur so können die Betroffenen und deren Angehörige eine individuelle Abwägung des Nutzens und des Risikos bzw. der Herausforderungen bei der Verabreichung von Lecanemab vornehmen.
Hier geht es zur Studie von Dr. Jeffrey L. Cummings.