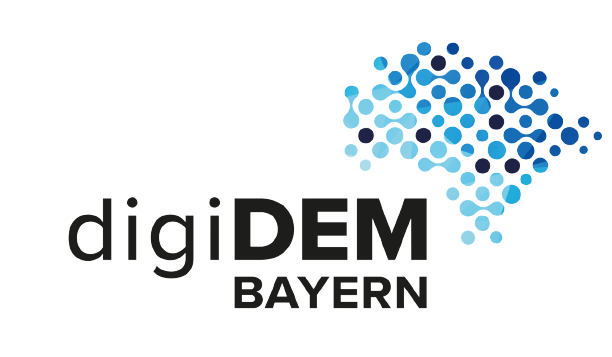Demenzvorsorge auf kommunaler Ebene – wie kann sie gelingen? Eine Studie aus den USA hat untersucht, wie ältere Menschen mit ihren Testergebnissen und den Informationen, die sie nach dem Test erhalten haben, umgehen. So teilt mehr als die Hälfte der Studienteilnehmenden ihre Screening-Ergebnisse der Familie mit, gut ein Drittel informiert medizinische Fachkräfte.
Das Ziel einer Studie aus den USA war es, ein Screening-Programm auf leichte kognitive Beeinträchtigung (Mild Cognitive Impairment, MCI) und auf Demenzen aller Arten zu bewerten. Die Studie zeigt, dass ein sogenanntes gemeindebasiertes Demenzscreening-Programm bei älteren Erwachsenen verschiedener ethnischer und sozialer Gruppen gut ankommt und umsetzbar ist. „Die Idee war, Demenzscreening mit allgemeinen Gesundheitschecks zu verbinden, um Stigma abzubauen und die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen“, heißt es in der Studie.
Demenz-Screenings vor Ort
Das Programm wurde direkt zu den Menschen in die Stadtteile gebracht, was Mobilitätshürden reduzierte. Rekrutiert wurden 288 Teilnehmende ab 55 Jahren aus den New Yorker Bezirken Manhattan, Queens und Brooklyn – über lokale Kooperationen, Mundpropaganda oder Bildungsseminare. Die Screenings fanden in Bibliotheken, Wohnanlagen und Gemeindezentren oder auch im Forschungszentrum statt. Erhoben wurden Daten aus vier Bereichen: kognitive Funktion, körperliche Gesundheit, allgemeine Funktionalität sowie der Stimmung, gemessen anhand von möglicherweise vorliegenden Depressionen und Ängsten.

Ermutigungen und Feedback
Nach dem Test erhielten die Teilnehmenden Empfehlungen. Sie wurden ermutigt, Ergebnisse mit medizinischen Fachkräften und der Familie zu besprechen, „unabhängig vom Befund, um Arztgespräche und Lebensstiländerungen zu fördern“, so die Forschenden. Hinzu kam ein schriftliches Feedback, in dem etwa auf Demenz-Risikofaktoren hingewiesen wurde.
Nach 60 Tagen wurden die Teilnehmenden erneut kontaktiert, um zu ermitteln, wie die Teilnehmenden mit den Testgebnissen umgehen und inwiefern sie sich an Ratschläge etwa hinsichtlich der Nachsorge halten, ob sie ihr Testergebnis mit der Familie teilen und ob sie aufgrund des Testergebnisses ihren Lebensstil ändern.
Wichtige Forschungserkenntnisse
Knapp 93 Prozent der Teilnehmenden berichteten von einem positiven Erlebnis mit dem Screening-Programm. 56 Prozent und damit mehr als die Hälfte der Teilnehmenden hat die Screening-Ergebnisse mit der Familie geteilt hat. Gut ein Drittel (32 Prozent) informierte medizinische Fachkräfte. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden, 58 Prozent, änderten ihren Lebensstil, indem sie sich besser ernährten, sich mehr bewegten oder nicht mehr rauchten. „Manche kombinierten Lebensstil mit sozialen Aktivitäten, rechtlicher/vorsorglicher Planung und kognitiver Stimulation.“
Diejenigen, die ihre Ergebnisse teilten, kritisierten jedoch die Reaktion ihrer Ärzte und Pflegekräfte. Diese hätten an den Ergebnissen kein Interesse gezeigt. Positiv ist aber, dass in 25 Prozent der Fälle weiterführende Tests veranlasst wurden.
Besprechung in der Familie
Insgesamt legen die Daten legen nahe, dass ältere Erwachsene mit schlechter körperlicher Gesundheit, etwa schlechter Blutzuckerregulation oder Mobilitätseinschränkungen, eher bereit sind, ihre Screening-Ergebnisse mit den medizinischen Fachangestellten zu teilen. Menschen mit guter kognitiver Gesundheit informieren eher ihre Familie über das Screening. „Es ist auch denkbar, dass Testergebnisse von körperlichen Beschwerden eher geteilt werden als bei kognitiven Störungen, da diese oftmals mit Stigmata verbunden sind“, so die Studie. Besonders bei Minderheiten spiele die Familie eine wichtige Rolle als emotionaler und finanzieller Unterstützer. „In der Latino-Kultur werden medizinische Themen häufig gemeinsam mit der Großfamilie besprochen und beschlossen.“
Kognitive Tests sind sinnvoll
In der Studie berichteten die Forschenden auch von einer Umfrage der Alzheimer‘s Association: Fast alle Mitarbeitenden im Gesundheitssystem und 80 Prozent der Älteren halten kognitive Tests für sinnvoll. Doch weniger als die Hälfte der Älteren erhielt je einen kognitiven Test. „Patienten erwarten, dass Ärzte Screenings empfehlen“, Ärzte warten jedoch oft darauf, dass die Menschen zunächst Beschwerden vorbringen. Zusammenfassend heißt es in der Studie: Programme auf Gemeindeebene können die Erkennung von leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) und Demenzen aller Arten verbessern und patientenorientierte Entscheidungen fördern.
Tipp für die Praxis: Die Studie zeigt bei dem Großteil der Teilnehmenden ein positives Erlebnis mit Screening-Testungen. Nehmen Sie mögliche Angebote zur Überprüfung Ihrer Gedächtnisleistung in der Gemeinde wahr. Eine Übersicht über die kommenden digiDEM-Bayern-Demenz-Screeningtage finden Sie hier.
Hier geht’s zur Studie:
What older adults do with the results of dementia screening programs